
Das Martin-Butzer-Gymnasium gibt es nun schon seit mehr als 250 Jahren. Wir Schülerinnen und Schüler können uns unsere Schule, wie wir sie heute kennen, mitsamt ihrem Schulsystem und all den großen und kleinen Besonderheiten gar nicht mehr anders vorstellen. Doch wie war unsere Schule früher strukturiert? Wie sah der damalige Schulalltag im Vergleich zu unserem aus?
Wir haben uns für euch umgehört und ein Interview mit Herrn von Dewitz geführt, der mit seinem Jahrgang vor 50 Jahren an unserer Schule sein Abitur gemacht hat. Im vergangenen September sind die ehemaligen Schülerinnen und Schüler zu einem gemeinsamen Jahrgangstreffen angereist und haben sich zusammen unsere Schule angesehen.
StilEcht: „Hallo. Wir freuen uns sehr, Sie interviewen zu dürfen und mehr über das „MBG von damals“ erfahren zu können!“
Herr von Dewitz: „Sehr gerne.“
StilEcht: „Wie groß war die Schule damals? Wie viele Schüler gab es insgesamt?“
Herr von Dewitz: „Ganz grob geschätzt, hatte die Schule damals etwa 500 Schüler, davon waren vielleicht ein Viertel Internatsschüler. Diese Zahlen beinhalteten allerdings auch eine Realschule, die sich in dem Block befand, in dem heute Ihre Schulleitung ihre Büros hat.“

StilEcht: „Sie hatten in einer voran gegangenen E-Mail erwähnt, dass Sie am Internat waren. Wie war das Internatsleben denn so? Haben dieses Angebot viele Schüler wahrgenommen?“
Herr von Dewitz: „Ihre Frage, ob viele Schüler das „Angebot Internat“ angenommen haben, zielt meines Erachtens in die falsche Richtung. Das Internat war, nüchtern betrachtet, ein Auffangbecken für Schüler und Schülerinnen aller Alters- und Klassenstufen, die aus den unterschiedlichsten Gründen dort „untergebracht“ wurden. Es gab zerrüttete Familien, in denen das Kind zum Schutz seiner Entwicklung ins Internat geschickt wurde, es gab Kinder, die in ihrem Umfeld so viele Probleme hatten, dass die schulische Leistung in den Keller ging, und daher das Internat als Rettungslösung angedacht wurde. Wir hatten auch Kinder von ranghohen Diplomaten aus Bonn, die regelmäßig ihre Dienstorte wechselten. Entsprechend mussten die Kinder mit umziehen und wurden dann für ein oder zwei Jahre ins Internat gesteckt. Es gab viele weitere Motive, aber ich glaube nicht, dass auch nur ein Schüler dabei war, der von sich aus gesagt hat, dass es für seine Entwicklung und seinen Notenschnitt oder Ähnliches das Beste wäre, ins Internat zu gehen. Ohne mich jetzt genau festlegen zu können, denke ich, dass die geographische Herkunft der Internatsschüler bis maximal Düsseldorf im Norden, Mannheim im Süden und Trier oder Saarbrücken im Westen reichte, Schwerpunkte waren sicher der Großraum Bonn und Koblenz.
Das Internat an der MBS war aufgeteilt in sogenannte Familien, das heißt, ein Erzieher hatte zwischen 15 und 20 Jungs in seiner Familie. Für die Mädchen, die grob geschätzt nur vielleicht 10% der Internatsschüler ausmachten, gab es nur eine zentrale „Familie“. Die Mädchen waren alle untergebracht in dem heute noch existierenden Gebäude oberhalb des Küchenblocks an der Straße. Sofern ich das richtig verstanden habe, sind da heute im Wesentlichen die Musikschule und Räume zum Lernen für die Oberstufe untergebracht.
Für die Jungs fing es (wenn sie wie ich quasi von Beginn an dabei waren) im Unterstufenheim oberhalb der Schule, also auf der anderen Seite der Straße nach Brückrachdorf, an. Wir waren in Schlafräume von vier bis max. sechs Schülern aufgeteilt, man blieb dort von der Sexta (heute 5. Jahrgangsstufe) bis höchstens Quarta (heute 7. Jahrgangsstufe). Dr. Joost, der als einziger Erzieher auch Lehrer am Gymnasium war, und seine Frau leiteten dieses Unterstufenheim. Es gab pro Zimmer einen Stubenältesten, der vermeintlich älteste und reifste Schüler von uns allen wurde zum Heimsprecher ernannt, dem wir alle zu gehorchen hatten. Wir konnten dort unter Aufsicht Hausaufgaben machen, aber genauso viel Zeit und viel Platz gab es zum Spielen und zur Gartenarbeit. Zu den Mahlzeiten marschierten wir immer wie die sieben Zwerge hintereinander vom U-Heim über die Johanniterstraße zum Speisesaal, den es ja heute noch gibt.
War die Erziehung streng? Na ja, ich will hier nicht als Nestbeschmutzer gelten, aber vor Frau Joost hatten wir alle „Angst“, Dr. Joost hatte einen kleinen Rohrstock (genannt „Zittergeist“), der schon mal als Bestrafung auf dem einen oder anderen Allerwertesten tanzte. Im Gedächtnis geblieben ist mir das heimliche Rauchen einer (natürlich) verbotenen Zigarette, bei dem ich mit zwei anderen Jungs „erwischt“ wurde. Die Strafe von Herrn Dr. Joost bestand darin, dass wir drei in einem vollständig verschlossenen kleinen Raum (Größe etwa eine Gästetoilette in einem normalen Wohnhaus) eingesperrt wurden und nicht eher den Raum verlassen durften, bis jeder von uns eine Zigarre komplett weggepafft hatte und wir dann mit grünen Gesichtern vermeintlich vom Rauchen kuriert worden waren, wohlgemerkt mit 12 Jahren.
Im Gedächtnis ist mir auch noch eine große „Performance-Tafel“, die in der Eingangshalle im Treppenhaus hing. Jeder von uns hatte auf dieser Tafel eine Doppelspalte mit voller Namensnennung für sich. Alle Klassenarbeiten mussten von Dr. Joost abgezeichnet werden. Für ein „sehr gut“ gab es 5 blaue Punkte, für ein „gut“ gab es drei und für ein „befriedigend“ einen blauen Punkt. „Ausreichend“ brachte in der zweiten Spalte einen roten Punkt, „mangelhaft“ drei und „ungenügend“ fünf rote Punkte. Jeden Tag lief man an dieser Tafel vorbei und jeder konnte sehen, wer von uns eher im blauen oder eher im roten Bereich angesiedelt war, das führte natürlich zum Lästern und zum Mobben (auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab).
Ich möchte gar nicht wissen, was pädagogische Experten heute zu dieser Art von Erziehung sagen würden. Das darf nicht falsch verstanden werden. Dr.Joost war insgesamt ein sehr einfühlsamer und hilfsbereiter Erzieher für uns vorpubertierende und mit Sicherheit nicht immer einfachen Jungs. Wir haben auch viel Spaß und liebevoll gestaltete kleine Feiern gehabt, aber wenn es um Dinge ging, die schief liefen, waren einfach noch „Strafen“ üblich und für uns „normal“ (auch in der Schule, siehe an anderer Stelle), die heute ein ziemlich strammes Verfahren gegen den Lehrer/Erzieher zur Folge hätten.
Was ich definitiv sagen kann ist, dass möglicherweise der eine oder andere Erzieher mal verbal oder mit Ohrfeige entgleiste, aber Dinge wie sexuellen Missbrauch oder sadistische Verhaltensweisen, wie sie Wolfgang Niedeggen (BAP), der ziemlich genau zur gleichen Zeit in einem von Mönchen geführten Internat in Rheinbach bei Bonn war, in seiner Biographie beschreibt, hat es zu unserer Zeit in Dierdorf garantiert nicht gegeben.
Wer die Unterstufe hinter sich hatte und in die Untertertia (heute 8. Jahrgang) versetzt wurde, kam in die „Familien“ von Frau Brünicke, Herrn Arndt (Spitzname „Dreifinger-Joe“, weil er an einer Hand durch einen Unfall nur noch drei Finger hatte), und später Herrn Freiherr Friedemann von Hammerstein und Herrn Michael. Das Internat insgesamt und den Oberstufenbereich im Besonderen leitete Herr Dankwart Goecke. Den Mädchenbereich leitete Frau Sperling.
Alle waren ausschließlich als Erzieher tätig und nicht parallel im Schuldienst. Die Zimmer waren bis auf wenige Ausnahmen mit max. zwei Schülern belegt. Die Gebäude existieren heute nicht mehr, sind aber auf Seite 39 des Bildbandes zum 50jährigen Bestehen noch zu sehen. Außerdem gab es einen großen Fernsehraum. Natürlich war klar geregelt, wer bis wann und was schauen durfte, es gab einen Tischtennisraum und auf allen vorhandenen Wiesen durfte mit dem Fußball gebolzt werden.
Unser Tag begann ohne Ausnahme mit dem Morgenlauf. Nach dem Wecken (geschätzt gegen sieben Uhr) mussten wir in so etwas wie Sportklamotten von unseren Häusern bis zum Wendepunkt (wo die Gymnasialstraße auf die Johanniterstraße trifft) traben und zurück zu den Häusern. Sommer wie Winter, bei Regen genauso wie bei Schneefall. Das Ganze wurde überwacht (damit man nicht nur spazieren ging oder gar vorzeitig wendete) von Erziehern oder von Oberstufenschülern des Internats. Das heißt, als wir älter waren, waren auch wir so privilegiert, die anderen überwachen zu dürfen.
Grundsätzlich war für die Internatsschüler alle 14 Tage Heimfahrtwochenende, die anderen Wochenenden blieb man im Internat. Ich selbst war ziemlich früh Mitglied im Fußballverein TuS Dierdorf geworden, mich zog es selten nach Hause, ich genoss meine Mannschaftskameraden und Freunde im Fußballclub und Dierdorf war für mich mehr zu Hause als meine Heimatstadt Leverkusen.
An den Internatswochenenden durften wir dann auch mal den Fernsehraum zu einer Disko umfunktionieren, wobei ich da gerne Diskjockey spielte, weil ich auch eins der leistungsstärksten Tonbandgeräte besaß. Allerdings kam es da auch vor, dass diese Veranstaltung zu relativ früher Stunde vom Internatsleiter brutal abgebrochen wurde, weil die Musik (Beat, Soul und alles rund um Flower Power und Woodstock) so laut war, dass in den umliegenden Wohnungen der Erzieher vermutlich Gläser und Geschirr vibrierten.
Das änderte sich aber in der Oberstufe, denn dort hatten wir einen eigenen Partykeller, dessen Decken mit Eierkartons zugeklebt waren. Dort gab es eine ordentliche Musikanlage, eine Glitzerkugel an der Decke und nur farbige und zum Teil richtig schummerige Beleuchtung. Dieser Raum war für die Oberstufe rund um die Uhr offen und, was ganz wichtig war, alle Mädchen aus dem Internat, die mindestens 16 Jahre alt waren, durften dort auch hinkommen. Wir saßen dort oft, in jeder freien Minute, um zu rauchen, zu quatschen, uns über irgendetwas aufzuregen, Blödsinn oder Party zu machen und die ersten vorsichtigen Annäherungen zum anderen Geschlecht zu erfahren.
Der wesentliche Unterschied im Internat zwischen normalen Wochentagen und dem Wochenende bestand im Frühstück. Von Montag bis Freitag gab es ohne jede Ausnahme Haferbrei, ein aus Haferflocken, Milch und Zucker zusammengekochter Brei, in unseren Augen ziemlich nah verwandt mit Tapetenkleister. Man saß auch hier in „Familien“ zusammen, die Erzieher mittendrin. Sie konnten also genau sehen, wer seinen Brei aß und wer nicht. Insbesondere Dr.Joost achtete bei seinen U-Heim-Schülern peinlich genau darauf, dass die Teller leer gegessen wurden. Der Unterschied am Wochenende bestand darin, dass es Haferflocken, Milch und Zucker separat gab. Man konnte sich also seine „Mahlzeit“ selbst zusammenstellen.
Die einzige Ausnahme zu diesem Einheits-Frühstück hatte der jeweilige Abiturientenjahrgang zwischen dem schriftlichen und dem mündlichen Abitur (ca. 3 Wochen). Man saß zusammen, hatte ein „normales“ Frühstück mit Brot, Käse und Aufschnitt und wurde sogar bedient. Ansonsten musste nämlich jede „Familie“ bei den Mahlzeiten brav in Reih und Glied in der Küche an der Theke antreten und seine Mahlzeit abholen.
Es ist, glaube ich, kein großes Wunder, dass bei etlichen ehemaligen Internatsschülern die damalige Speisenauswahl noch heute nachwirkt. Die Küche war nicht schlecht, nur, wenn man bestimmte Dinge immer wieder essen muss, kann dies schon Einfluss auf heutiges Essverhalten haben. Ich habe seit dem Internat keine Haferflocken mehr angerührt, auch Blutwurst, Lauchgemüse, Schwarzwurzeln (nachgemachter Spargel in fetter Bechamélsauce) und panierten Leberkäse (falsches Schnitzel, genannt „Schlafrock“) habe ich nie wieder anrühren können.“
StilEcht: „Welche Fächer gab es? Gab es in der Oberstufe auch Leistungskurse, ähnlich wie heute?“
Herr von Dewitz: „Ein paar Dinge muss man vorab erläutern, das gilt vor allem für die Benennung der Klassen. Es gab die Unterstufe (Sexta, Quinta und Quarta – heute 5., 6., und 7. Klasse), dann die Mittelstufe, die mit der mittleren Reife endete (Untertertia, Obertertia, Untersekunda – heute 8.,9. und 10. Klasse) und die Oberstufe (Obersekunda, Unterprima, Oberprima – heute 11., 12. und 13. Klasse).
Grundsätzlich waren wir von Sexta bis Oberprima eine gemeinsame Schulklasse, es gab in der Oberstufe noch kein Kurssystem. Wir starteten in der Sexta mit 34 Schülern, davon waren 9 Mädchen – unsere höchste Klassenstärke hatten wir mit 40 Schülern und Schülerinnen in der Obertertia (9. Klasse). Tatsächlich gab es nur eine Startklasse, heute gibt es nach Aussage von Herrn Hassel bis zu 200 Anmeldungen pro Schuljahr.
Ein weiterer wichtiger Einschnitt unserer Schulzeit waren die sogenannten Kurzschuljahre. Bis Mitte der 60er Jahre war Beginn und Ende eines Schuljahres immer die Osterferien. Es wurde bundesweit beschlossen, diesen Schuljahreswechsel auf den Sommer zu verlegen, so wie es heute noch ist. Das hieß für uns, zwischen Ostern 1966 und Sommer 1967 hat man zwei Kurzschuljahre „veranstaltet“, Ostern bis Weihnachten und dann Neujahr bis Sommerferien. Unsere Klassen betraf das mit der Untertertia und der Obertertia, also die Klassen 8 und 9 heute.
Das war rückwirkend betrachtet vielleicht etwas stressiger für uns, andererseits würde ich schon sagen, dass die Bewertung unserer Leistungen in den zwei kurzen Jahren etwas „weicher“ war. Umso härter wurde dann in der Untersekunda (10. Klasse) gesiebt. Aus dem Bauchgefühl geschätzt waren es fast 25% unserer Klasse, die die „mittlere Reife“, also den Übergang in die Oberstufe, nicht schafften.
In den ersten sechs Schuljahren hatten wir immer nur gemeinsam Unterricht, Trennungen gab es stundenweise für den Religionsunterricht und für die ab Klasse 7 zu treffende Entscheidung zwischen Latein oder Französisch. In der Oberstufe konnte man dann noch wählen, ob man mit naturwissenschaftlichem oder sprachlichem Schwerpunkt ins Abi gehen wollte. Die Stunden des gewählten Schwerpunktes fanden dann immer parallel zueinander statt. Interessant war, dass die Naturwissenschaft (9 Schüler) eine rein männliche Angelegenheit war, möglicherweise mitgeprägt durch die schmerzhaften Erfahrungen mit Lehrer „Fritze“ Thierbach (siehe unter Lehrer). Schließlich konnte man kurz vor dem Ende der Schulzeit noch zwischen Kunst und Musik wählen.
Der Sportunterricht fand zumindest in der Halle getrennt für Mädchen und Jungs statt. Bis auf die paar Monate, die Leichtathletik auf dem Sportplatz des TuS Dierdorf möglich machten, bestand der Unterricht aus Geräteturnen und diversen Mannschaftsspielen (Handball, Basketball, Volleyball).
Die Mädchen hatten in der kleineren oberen Halle parallel Gymnastik und Turnen. Der Geräteraum oben verfügte über große Fenster, durch die man in die „große“ Halle auf uns hinunterschauen konnte. Wie oft sahen wir dort oben grinsende und lachende Gesichter der Mädchen, wenn wir uns an Barren und Reck quälten oder bewundernde Blicke (zumindest hofften wir das), wenn die starken Hand- und Basketballer sich in den Vordergrund spielten.“

StilEcht: „Wie sind die Schülerinnen und Schüler zur Schule gekommen? Gab es Schulbusse?“
Herr von Dewitz: „Diejenigen, die nicht im Internat waren (und das war die große Mehrheit), hießen im Alltag „Fahrschüler“. Der tägliche Schulweg wurde unterschiedlich gestaltet. Die Schüler/innen aus Dierdorf, Brückrachdorf, Giershofen, Wienau (also unmittelbare Umgebung) kamen in der Regel per Fahrrad oder zu Fuß. Wer irgendwo in der Nähe der damaligen Eisenbahnstrecke Altenkirchen – Montabaur wohnte (also z.B. Raubach und Puderbach im Norden, Selters und Siershahn im Süden), musste zum Teil zunächst mit dem Fahrrad bis zum nächsten Bahnhof. Vom Bahnhof Dierdorf ging es dann zu Fuß zur Schule. Das waren dann schon zeitaufwändige Wege.
Michael Novak (übrigens der jüngere Bruder von Ina Novak-Volkmann, die über drei Jahrzehnte an der MBS war), damals sogenannter Fahrschüler, beschreibt wie folgt: „In den beiden ersten MBS-Jahren gab es für mich noch keinen Schulbus. Dierdorf wurde folgendermaßen erreicht: Vom Wohnort Urbach aus per Fahrrad – auch in den seinerzeit noch sehr viel strengeren Wintern mit oft viel Schnee – auf zudem noch nicht so ganz guten Straßen nach Raubach, Distanz schätzungsweise vier bis fünf Kilometer. Von dort mit dem roten Schienenbus der Deutschen Bahn über Wienau nach Dierdorf „Hbf“. Von hier wiederum zu Fuß zur MBS. Man musste schon ca. eine Stunde für die Anreise einrechnen; nach Schulschluss ging es in umgekehrter Reihenfolge zurück. Ab dem 3. MBS-Jahr wurde ein Schulbus eingeführt. Ab Urbach führte die Rundreise über Dernbach, Kleinmaischeid, Großmaischeid, Stebach und Giershofen nach Dierdorf – und nach Schulschluss zurück. Viel schneller war es nicht, aber deutlich angenehmer, vor allem in der dunkleren Jahreszeit.“
Für die Schüler, die aus östlicher Richtung anreisten (Herschbach, Marienhausen etc.), gab es einen Schulbus, der allerdings nicht an der Schule hielt, sondern dort, wo die Johanniterstraße auf die Hauptstraße trifft, wo es, wenn ich richtig informiert bin, heute die Bäckerei Haubrich gibt, früher war dort das Café „Süße Ecke“, in welchem nicht nur etliche Lehrer regelmäßig ihren Nachmittagskaffee einnahmen, sondern auch viele von uns ihre ersten vorsichtigen „Dates“ hatten, in dem man die Angebetete zur Torte oder zum Eis einlud. Von dort mussten die Schulbus-Insassen dann zu Fuß zur Schule laufen.
Auf dem Weg war nach etwa 100 Metern auf der linken Seite der Laden von Frau Letschert. Frau Letschert verkaufte zwar schwerpunktmäßig Schulzubehör, aber sie hatte auch alles, was man heute in einem Kiosk findet. Entsprechend deckte man sich morgens auf dem Weg zur Schule noch mit Süßigkeiten ein.
Für die U-Heim-Schüler hatte der Laden eine besondere Bedeutung. Jeder von uns hatte ein „Scheckheft“. Wenn irgendetwas gebraucht wurde (Hefte, Schreiber, Schulbücher usw.), füllten wir einen Scheck aus, den Dr. Joost dann unterzeichnete und wir konnten mit diesem Scheck bei Frau Letschert einkaufen gehen und dann bar andere Dinge dazu kaufen. Frau Letschert hat dann wohl mit dem Internat monatlich abgerechnet. Dieses „selbst-einkaufen-gehen“ fühlte sich für uns großartig an und die alte Frau Letschert mochten wir ausgesprochen gerne. Ich denke, wir waren auch für sie so ein wenig Kinder- oder Enkelersatz.“
StilEcht: „Waren die Lehrer sehr streng?“
Herr von Dewitz: „Wenn wir hier über unsere Lehrer sprechen, muss eins vorausgeschickt werden. Alle hatten, entweder als Kinder oder als junge Erwachsene, den zweiten Weltkrieg erlebt, von den älteren Lehrern (von denen wir relativ viele hatten) war sicher die Mehrheit auch als Soldaten im Einsatz. Zwei unserer Lehrer waren deutlich gehbehindert. Wir hatten vermutet, dass sie eine Holzprothese als Bein hatten, so etwa „Hugo“ Scholz und Dr. Jakobi.
Unseren langjährigen Lateinlehrer Dr. „Niko“ Ulbricht nannte man deshalb Niko, weil er gefühlt rund um die Uhr kleine stinkende schwarze Zigarillos rauchte, vor dem Unterricht in irgendeinem verfügbaren Blumentopf außerhalb der Klasse ablegte und nach dem Unterricht sofort wieder ansteckte und weiterpaffte. Niko hatte definitiv eine extrem schwere Zeit als Kriegsgefangener in einem Bergwerk hinter sich. Etwa ein halbes Jahr vor unserem Abitur wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er noch vor unserem Abi an Lungenkrebs verstarb.
Das bedeutet, wir hatten eine ganze Reihe (geschätzt 50% des Kollegiums) von relativ alten Lehrern und Lehrerinnen, nicht nur alt an Jahren, sondern auch sichtbar gealtert durch die persönlichen Erfahrungen im Krieg und in den ersten Jahren danach. Als wir Abitur machten (oder kurz vorher), gingen die ersten in den Ruhestand und aus heutiger Sicht gesehen waren das mit ca. 65 Jahren wirklich alte Menschen. Undenkbar, dass es einer von den 55 – 65jährigen körperlich geschafft hätte, wie ich heute mit 69 drei bis vier Mal in der Woche mit zwanzig Kilogramm Gepäck auf dem Rücken sieben Kilometer über einen hügeligen Golfplatz zu gehen. Die Ausnahme war Herr Krüger, der älteste der Sportlehrer. Aber auch bei ihm als ehemaligem Handballnationalspieler waren beide Knie so lädiert, dass er bei regelmäßigem aktivem Sport an seine körperlichen Grenzen kam.
Ich erzähle dies, weil natürlich auch die pädagogische Ausbildung von vielen dieser Lehrkräfte noch aus einer Zeit stammte, die insbesondere unsere Lehramtsstudenten schon nicht mehr nachvollziehen konnten. Fachlich waren alle Lehrer ohne Ausnahme richtig gut, in Sachen Autorität gab es riesige Unterschiede, das wird heute nicht anders sein. Es gab welche, die kamen in den Klassenraum und ohne dass irgendein Kommentar nötig war, war die Klasse mucksmäuschenstill und aufmerksam, keiner traute sich, Blödsinn zu machen. Andere (wie Niko) versuchten die ganze Schulstunde vergeblich, mal mit Bitten, mal mit Brüllen, uns zur Ruhe und Aufmerksamkeit zu bringen. Wir haben weiter gequatscht, sind sogar aufgestanden und an andere Tische marschiert, haben uns, kurz gesagt, nur begrenzt dafür interessiert, dass da eine Lehrperson im Raum war.
Ein paar Beispiele für Lehrerverhalten, welches man sich heute wahrscheinlich kaum noch vorstellen kann:
Einer der sogar noch jüngeren Lehrer, Herr Köhler, hat definitiv (und einmal war ich selbst der Leidtragende) das eine oder andere Mal, wenn ihm Schüler richtig freche Antworten gaben, „aus der Hüfte geschossen“, das heißt, seine Hand kam blitzartig von unten hoch und landete klatschend im Gesicht von Schülern, immer männlichen, was vermutlich daran lag, dass Mädchen grundsätzlich eher keinen Anlass zur Aufregung gaben. Als Herr Köhler einmal unserem Mitschüler Erwin Seeligmüller eine Ohrfeige verpasste, gab es fast einen Skandal. Erwin (ein extrem sportlicher und durchtrainierter junger Mann) erhob sich und baute sich vor Herrn Köhler auf. Die Klasse brüllte geschlossen: “Hau zurück!“, was er aber nicht getan hat, obwohl er wohl kurz davor stand.
Herr Dr. Schullerus, der wohl aus Siebenbürgen (heute Rumänien) stammte und mit einem sehr markanten Akzent sprach, beobachtete einmal im Religionsunterricht, dass Karin Krüger bei Michael Novak die Mathehausaufgaben abschrieb. Eigentlich war Dr. Schullerus ein ruhiger und sehr besonnener Lehrer, aber diese Szene machte ihn aus welchen Gründen auch immer so zornig, dass er sich das Hausaufgabenheft von Karin schnappte und es vor unseren Augen in etliche Teile zerriss.
Unser Schulleiter war Herr OStDir Dr. Stumbries. Er unterrichtete vor allem Deutsch und Geschichte und war sicher auch aus heutiger Sicht ziemlich modern. Es gab bei ihm die ersten Gruppenarbeiten, er las auch Klassenarbeiten (Aufsätze) ohne Nennung des betreffenden Schülers vor und ließ die Klasse die Qualität beurteilen, mit ihm Details diskutieren und einen Notenvorschlag machen, dem er mit seiner finalen Benotung immer sehr nahe kam.
Allerdings hatte er auch eine „wunde“ Stelle. Wenn er zum Unterricht kam und wir merkten, dass er entweder nicht richtig motiviert oder vorbereitet war, mussten wir ihn nur bitten, uns Geschichten aus der Kriegszeit zu erzählen und die Stunde war gelaufen, weil er dann immer neue Erlebnisse aus seinem Gedächtnis holte.
Seine Frau unterrichtete auch bei uns. Im Gedächtnis geblieben ist mir eine Szene aus der Mittelstufe, als unser Klassenkamerad Karl-Hans B. im Unterricht mit dem Finger aufzeigte, er müsse dringend auf die Toilette. Frau Stumbries erlaubte dies trotz mehrfacher Bitte nicht und Karl-Hans B. hat es tatsächlich nicht aushalten können und sich eingenässt. Eine größere Peinlichkeit für einen 13-14jährigen, als mit deutlich sichtbar nasser Hose da zu sitzen, kann man sich kaum vorstellen, eine pädagogische Glanzleistung von Frau Stumbries.
Eine ganz besondere Stellung in unseren Erinnerungen hat unser damaliger Physiklehrer „Fritze“ Thierbach, Vater von Michael Thierbach, der ja auch über drei Jahrzehnte an der Schule lehrte. Er konnte toll erklären und leitete Formeln an der Tafel fast immer so ab, dass man sie gut nachvollziehen konnte. Wenn aber jemand seinen Gedankengängen und Ableitungen nicht folgen konnte, die Hausaufgaben nicht gemacht hatte oder die Formel nach der zweiten Erklärung immer noch nicht verstanden hatte, wurde er richtig wütend. Er brüllte dann los, dass manchem Mädchen sicher die Tränen in den Augen standen: „Du Lieschen du, wie kann man nur so doof sein!“ oder „Du bist so doof, doof, doof!“ oder „Rosen, Tulpen und Narzissen, der Mensch kann doof sein, er muss sich nur zu helfen wissen!“ Als Krönung feuerte er dann mehr als einmal seinen Schlüsselbund quer durch den Saal in Richtung des vermeintlich blöden Schülers. Wie gesagt, er war eigentlich ein richtig guter Lehrer, bei dem wir viel Naturwissenschaft gelernt haben, und konnte auch witzig sein, aber Geduld war nicht seine Stärke und seine Emotionsausbrüche waren legendär.
Auch das Thema Spitznamen, die Lehrer einigen von uns gaben, war damals eher harmlos. Heute könnte das allerdings schon anders ausgehen. 1968 machte Herrad Schmidt Abitur, ein Mädchen mit langen hellblonden Haaren. Da ich auch richtig hellblond war und irgendwann die Haare ziemlich lang wachsen ließ, war ich für Sportlehrer Dr. Dieter Kroppach ab einem bestimmten Zeitpunkt „Herrad“. Ich habe ihm das nie übelgenommen, wir haben uns wirklich gut verstanden und im letzten Schuljahr haben wir uns außerhalb der Schule sogar geduzt. Hintergrund war einfach, dass ich mit ihm gemeinsam in der Fußballmannschaft der SG Dierdorf/Wienau spielte. Ich war mit 18 Jahren der jüngste, Dieter mit 37 Jahren der älteste Spieler der Truppe.“
StilEcht: „Sie waren zeitweise Chefredakteur der damaligen Schülerzeitung? Wie war das? Gab es regelmäßige Ausgaben?“
Herr von Dewitz: „Wenn ich mich richtig erinnere, wurde die Schülerzeitung „MABUS“ erst 1968 oder sogar 1969 von zwei Schülern gegründet, die eine Klasse unter uns waren (Frank Kästner und Dirk Holtermann). Es erschienen zwei bis drei Ausgaben pro Jahr im DinA-5-Format, die circa zwanzig bis dreißig Seiten hatten, aber schon professionell auf Glanz gedruckt wurden und mit zahlreichen Fotos und Geschichten rund um die Schule gestaltet waren. Finanziert wurde das durch den Verkauf der Zeitung, aber auch durch etliche Werbeanzeigen von Dierdorfer Geschäftsleuten.
Mitte 1970 haben die beiden Gründer sich aus der Redaktion zurückgezogen. Da wir uns alle untereinander gut kannten (Dirk Holtermann war auch im Internat), übernahmen Franz-Josef Deimling (Abi 1972) und ich für zwei Ausgaben die Redaktion. Im Gedächtnis geblieben ist mir nur die letzte Ausgabe, bei der ich verantwortlich war, die Weihnachtsausgabe 1970. Diese Ausgabe war ein einziger, zum Teil bösartiger Protest gegen die Kommerzialisierung der Weihnachtszeit, den hemmungslosen Konsum, während in anderen Teilen der Welt Menschen hungerten usw. Sie enthielt nicht eine Zeile über die schöne und harmonische Weihnachtszeit (außer purem Zynismus) und kam sicher insbesondere bei den Eltern der Käufer überhaupt nicht gut an. Ich sehe das Titelbild noch vor mir: ein Foto von einem kleinen Orang-Utan, der auf einer Kloschüssel saß, darunter stand „Affe, Liebe verrichtend“.
Nachdem die ersten Lehrer sie gesehen hatten, wurde der Verkauf an der Schule verboten. Wir waren damals im wilden Revoluzzer-Alter (als unmittelbare Ausläufer der 68er), haben gegen alles und jedes protestiert und waren stolz auf diese Aktion und die öffentliche Reaktion.
Diese Protestlaune zog sich bei unserer Klasse bis ins Abitur. Wir waren die erste Klasse in der Geschichte der MBS, die auf eine öffentliche Feier mit Ball und Festessen zur Übergabe der Abi-Zeugnisse verzichtete. Wir haben uns unsere Zeugnisse formlos im Sekretariat abgeholt, eine Kneipe in Urbach gebucht, dort eine Riesenfete nach unserem Geschmack gemacht und nur die Lehrer eingeladen, die wir mochten, und die sind auch gekommen.
Ein Klassenkamerad wohnte in Urbach (Michael Novak) , dort wurde im Garten ein richtig großes Zelt aufgestellt und alle, die an dem Abend nicht mehr nach Hause wollten oder konnten, haben dann dort übernachtet.“
StilEcht: „Haben Sie sich während der letzten Jahrzehnte regelmäßig mit Ihrem Abi-Jahrgang getroffen?“
Herr von Dewitz: „Wie man auch in dem schönen grünen Band zum 50. Geburtstag des Martin-Butzer-Gymnasiums auf Seite 256 nachlesen kann, haben in unserer Klasse 29 Schüler und Schülerinnen ihr Abi gemacht, einer (Hartmut J.) ist „durchgefallen“ und hat sein Abi dann ein Jahr später gemacht. Von den 29 haben drei von Beginn an klargemacht, dass sie keinerlei Interesse an Klassentreffen hätten oder wir haben einfach jeden Kontakt verloren (zwei). Beate Nicolai ist wenige Monate nach dem Abi mit dem Auto tödlich verunglückt. Alle anderen 23 haben sich von Beginn an sehr regelmäßig getroffen, mal in kleinerer Runde (teilweise jedes Jahr), mal in größerer Runde (definitiv alle fünf Jahre).
Die 5-Jahres-Treffen fanden immer in Dierdorf statt, in den ersten Jahren konnte man sich sogar noch im Unterstufenheim einmieten, später im Waldhotel oder ähnlichen Orten. Immerhin lebte nur noch ein Pärchen (welches sich schon zu unserer Schulzeit gefunden hatte) in Dierdorf, aber die beiden haben sich immer wieder liebevoll um die Organisation gekümmert.
Auch heute noch kann man grob schätzen, dass etwa die Hälfte in NRW lebt, die andere Hälfte in Rheinland-Pfalz oder Hessen. Leider ist Edith Brendel-Gollnisch, die auch Lehrerin an der Gutenberg-Schule war, vor fünf Jahren verstorben und so haben Karin Krüger und ich die Organisation übernommen.
Einige unserer Lehrer waren bei diesen Treffen dabei. Spätestens Anfang der 80er Jahre waren wir dann aber unter uns, da unsere Lieblingslehrer alle verstorben waren.
Wir haben von vielen anderen Klassen gehört, dass deren Treffen nach dem zweiten oder dritten Mal eingeschlafen sind, weil man immer etwas Besonderes machen wollte, jeder wollte noch etwas Eindrucksvolleres organisieren als der Vorgänger.
Wir haben es geschafft, uns tatsächlich über 50 Jahre mindestens alle fünf Jahre zu treffen mit mehr als 20 Personen, einschließlich Partnern oder früheren Klassenkameraden, die dann „sitzen geblieben“ sind, aber sich dennoch nach wie vor sehr wohl bei uns fühlen. Ich glaube, der Grund ist einfach, dass wir keine Show oder sündhaft exquisite Treffen machen wollten, sondern einfach einen großen gemeinsamen Raum gesucht haben, in dem wir unter uns waren, Essen bestellen konnten (jeder nach seinem Geschmack und Geldbeutel) und bei etlichen (zum Teil auch recht alkoholischen) Getränken bis in die Nacht reden konnten, ohne Sitzordnung, jeder wechselte einfach mal die Gesprächsrunde.
Natürlich waren da etliche „Weißt Du noch…?-Geschichten“ dabei, aber es waren auch viele tief gehende Themen. Wir waren alle eine Altersgruppe, viele hatten ähnlich gelagerte Studien- oder Berufserfahrungen oder gar -probleme, die man austauschen konnte.
Fast immer haben wir vorher die Schule und lange Jahre auch das Internat aufgesucht, sind das eine oder andere Mal auch durch die Gebäude geführt worden. Wir sind auch gelegentlich über den Dierdorfer Friedhof gegangen, haben Gräber von unseren ehemaligen Lehrern und leider auch Schulkameraden gesucht und besucht.“
StilEcht: „Vielen Dank für Ihre ausführlichen Antworten!“
Herr von Dewitz: „Sehr gerne.“

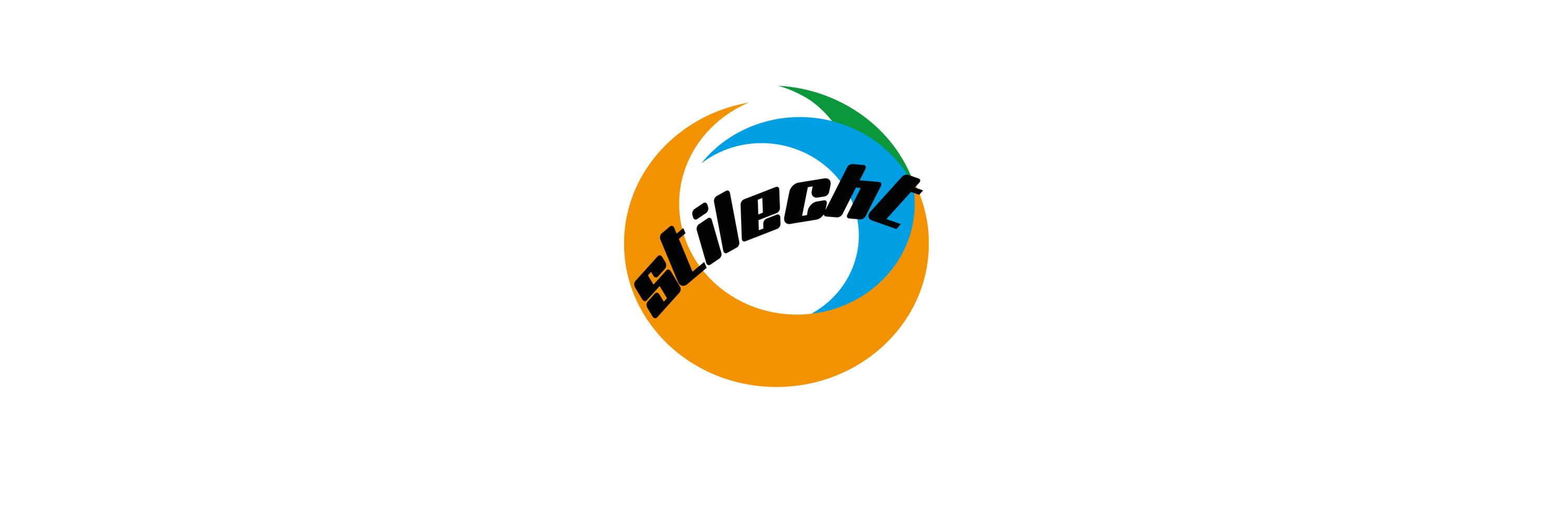
Schöne Erinnerungen : gut erzählt von Bertin von Dewitz. Ich erinnere mich noch immer gerne an die Internats- und die Schulzeit.Schade dass die Internatsgebäude fast alle abgerissen worden sind. Schöne Erinnerungen auch an Frau Letschert,ich hab mal durch Zufall ihren Sohn bei Facebook angeschrieben. Er erzählte mir, wie seine Mutter uns Internatsschüler „geliebt“ hat.Sie sprach von uns immer als „meine Jungs.“ Mein Erzieher war lange Jahre Friedemann von Hammerstein, genannt Flinti. War ne gute Zeit in Dierdorf Claus Schmidt
Auch ich war seit 1952 bis 1956 im Internat in Dierdorf. Für mich fing es nicht im Unterstufenheim an (damals Villa Schöppke?), sondern in einem Haus am Holzbach unterhalb der evang. Kirche. Wir wohnten damals unter dem Dach. Mein Zimmer war eine Nische im Flur, die mit Spinten verstellt war. Unter uns wohnte die Familie Jacobi. Er hieß bei uns Hinkebein.
Das wurde dann aufgegeben und wir zogen Ins Unterstufenheim. Von Dort kam ich dann ins Hauptgebäude. Der Direktor war Herr Hoffmann.